Auch westlich des Hudson River setzte schon frühzeitig eine Besiedlung des Gebietes ein. Zuerst ansässig wurden Indianer vom Stamm der Delawaren. Holländer kauften ihnen 1630 das Land ab, kurz danach wurden die ersten Häuser auf der schmalen Landzunge zwischen Hackensack River und Hudson errichtet. Bergen, das heute mit der städtischen Struktur von Jersey City verschmolzen ist, entwickelte sich von einer dörflichen Ansiedlung zur Kleinstadt. Ende des 17. Jahrhunderts übernahmen die Engländer die holländischen Besitzungen, es kam zur Festlegung neuer Grenzen und zur Bildung des Bergen County. Auch im Landesinneren hielten die Europäer Einzug. Puritaner gründeten 1665 Newark, ihre Herrschaft war aber nicht von allzu langer Dauer. Recht bald folgten andere Siedler, die mit den Prinzipien des Calvinismus wenig gemein hatten, so daß die Kirche mehr und mehr an Einfluß verlor. Allmählich setzte in Newark die Industrialisierung ein, Baumwollmanufakturen entstanden; den Ruf als Industriestandort begründete indes die Lederverarbeitung. Die Fertigstellung des Morris Kanals, sowie der Anschluß an die Eisenbahn begünstigten die Entwicklung und führten 1836 schließlich zur Verleihung des Titels "City of Newark". Anfang des 19. Jahrhunderts kam ein weiterer Wirtschaftszweig hinzu, das Bankengewerbe, das 1804 mit der Newark Banking Company seinen Anfang nahm. |
|
Jersey City, 1838 als selbständige Verwaltungseinheit im Bergen County geschaffen, übertraf bald die umliegenden Orte an Bedeutung, ein Aufstieg, der 1870 in der Gründung der "City of Jersey City" gipfelte, worin die Town of Bergen, die Town of Hudson (gegründet 1852) sowie später Greenville (gegründet 1863 - beigetreten 1873) aufgingen. Auch nördlich von Jersey City begann eine flächenhafte Bautätigkeit. Hoboken, 1784 von den Indianern erworben, profitierte von der Nähe zu New York und der Einrichtung von Fährverbindungen. Einige über den Atlantik nach Europa verkehrende Dampfschifflinien machten später hier fest, gleichzeitig entstanden Schiffswerften, die mehrere Tausend Arbeiter beschäftigten. Um die Jahrhundertwende stieg die Bedeutung als Verkehrsknoten enorm, verschiedene Eisenbahngesellschaften, so auch die Delaware, Lackawanna & Western Railroad, legten ihren Endbahnhof in Hoboken an. |
|
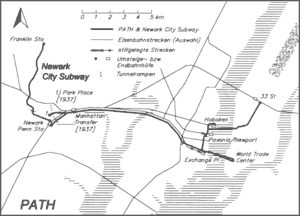 |
|
Vor diesem Hintergrund entstand in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Idee, einen Tunnel unter dem Wasser zu bauen, durch den die Züge dann direkt nach Manhattan gelangen könnten. Die Hudson Tunnel Railroad Company wurde gegründet und bald darauf mit den Arbeiten begonnen. 1874 kam es zu einer Unterbrechung, als die Delaware, Lackawanna & Western Railroad, die eine eigene Fähre über den Hudson betrieb, die unliebsame Konkurrenz witterte und erfolgreich dagegen intervenierte. 1879 konnte das Vorhaben weitergeführt werden, jedoch nur für eine kurze Zeit. Eine Explosion, bei der 20 Arbeiter getötet wurden, zwang erneut zur Einstellung aller Arbeiten. Nach zehnjähriger Pause startete man 1889 nochmals einen Versuch; Finanzprobleme der Hudson Tunnel Railroad Company ließen das Vorhaben im Jahre 1892 aber endgültig scheitern. |
|
Nun erschien eine neue Person auf der Bildfläche. William G. McAdoo (1863-1941), ein junger Rechtsanwalt aus Chattanooga, Tennessee, der sich schon bei der Elektrifizierung der Knoxville Street Railroad einen Namen gemacht gemacht hatte, dachte unabhängig von den Tunnelbauversuchen über eine Unterquerung des Hudson River nach. Seiner Auffassung nach sollten aber nicht die Eisenbahnen direkt, sondern eine elektrische Schnellbahn die Verbindung von den Endbahnhöfen in Jersey City nach Manhattan herstellen. McAdoo, der es verstand, finanzkräftige Quellen von seinen Ideen zu überzeugen, tat sich mit der bankrotten Hudson Tunnel Railroad Company zusammen und legte einen Plan vor, der unter Verwendung der halbfertigen Tunnelröhre eine Strecke vom Bahnhof der Delaware, Lackawanna & Western Railroad in Hoboken zur 33rd Street in Midtown Manhattan vorsah. Die Bauarbeiten begannen 1902; zusätzlich wurde ein weiterer Tunnel unter dem Hudson zwischen dem Bahnhof Exchange Place der Pennsylvania Railroad in Jersey City und Downtown Manhattan vorangetrieben. An der Cortlandt Street entstand der Endbahnhof, Hudson Terminal, mit einem doppeltürmigen, 22-stöckigen Bürogebäude oberhalb der Gleisanlagen. Noch vor der Eröffnung der ersten Strecke dachte man über eine Verlängerung in Manhattan nach, einmal von der 9th Street nach Astor Place, sowie von der 33rd Street zur Grand Central Station. Diese Vorhaben wurden aber zugunsten einer Streckenerweiterung in New Jersey wieder fallengelassen. Zwischen den beiden Bahnhöfen der Delaware, Lackawanna & Western und der Pennsylvania Railroad entstand eine Querverbindung, die bei Pavonia Avenue als dritten auch den Bahnhof der Erie Railroad an das Schnellbahnnetz anschloß. |
|
In einer feierlichen Zeremonie konnte am 25. Februar 1908 der erste Streckenabschnitt zwischen Hoboken und 19th Street in Betrieb genommen werden. Am 10. Juni erfolgte die Verlängerung bis zur 23rd Street, ein Jahr später, am 19. Juli 1909 wurde schließlich die zweite Strecke vom Hudson Terminal nach Exchange Place eingeweiht. Die Eröffnung der Verbindung zwischen Hoboken und Exchange Place fand am 2. August des gleichen Jahres statt, damit war das unterirdische Streckennetz im wesentlichen komplett. Am 10. März 1910 wurde der Tunnel unter der Sixth Avenue von der 23rd Street bis zur 33rd Street verlängert, mit einem heutzutage nicht mehr existierenden Zwischenhalt bei der 28th Street (auch bei der 19th Street befand sich bis 1954 eine Station, die aber im Zuge der Erhöhung der Reisegeschwindigkeit und auf Grund der Nähe der angrenzenden Bahnhöfe geschlossen wurde). Ebenfalls im Jahre 1910, am 6. September, erfuhr der westliche Streckenast von Exchange Place bzw. Pavonia/Newport bis Grove Street eine Erweiterung um eine Station. |
|
 |
An der 33rd Street stößt die PATH am weitesten nach Norden, in das Zentrum von Midtown Manhattan vor. Unter und neben der Bahnhofsanlage befinden sich die Gleise der Sixth Avenue Line der IND. |
Der nördliche der beiden Unterwassertunnel, zwischen Hoboken und Midtown Manhattan, besitzt eine Länge von etwa 1,7 Kilometer, und erreicht eine maximale Tiefe von 29,5 Metern unter der Wasseroberfläche. Der näher an der Mündung des Hudson gelegene Tunnel, ebenso lang wie der andere, liegt bis zu 27,4 Metern tief, 4,5 bis 12 Meter unter dem Flußbett. Beide Tunnel bestehen aus je zwei einzelnen Röhren mit einem Durchmesser von 4,64 Metern, die in einem Abstand von mindestens neun Metern nebeneinander verlaufen. Da das Hudson Terminal in einer Schleifenfahrt bedient wird, gabeln sich die beiden südlichen Tunnelröhren in Richtung Manhattan auf, in der Mitte des Flusses beträgt die Entfernung zwischen beiden bereits 73 Meter. Die Energie wird von einer seitlichen Stromschiene abgenommen, die Spannung beträgt wie bei der IRT 650 Volt. Auch der Wagenpark entstand in Anlehnung an die Fahrzeuge der New Yorker U-Bahn; erste Probefahrten erfolgten 1907 auf der Second Avenue Line der Hochbahn in Manhattan. Alle Stationen besitzen eine Bahnsteiglänge von 112 Metern und beschränken sich im Normalfall auf die beiden Hauptgleise, mit entweder einem Mittelbahnsteig (Grove Street, Pavonia/Newport, Christopher Street, 9th Street) oder zwei äußeren Seitenbahnsteigen (14th Street, 19th Street, 23rd Street und 28th Street). Exchange Place weist zwei getrennte eingleisige Bahnsteigtunnel auf, die durch einen Quergang miteinander verbunden sind. Pavonia/Newport besitzt einen zusätzlichen Bahnsteig am östlichen Gleis, der jedoch regulär nicht mehr benutzt wird. Die Terminals in Hoboken und an der 33rd Street lassen eine annähernd gleiche Gestaltung erkennen. Beide verfügen über drei Gleise mit zwei Mittelbahnsteigen, Hoboken zusätzlich über einen, die Station bei der 33rd Street über zwei äußere Bahnsteige. |
|
|
Gewölbe bestimmen in den an die Unterwassertunnel anschließenden, in größerer Tiefe gelegenen Stationen das Bild. Während Exchange Place mit zwei separaten Bahnsteigtunneln ohne Stützen auskommt, muten die Bahnhöfe Pavonia/Newport und Hoboken (s. Abbildung) mit ihren Säulen und Kapitellen wie Katakomben an. In Hoboken befindet sich der unterirdische Bahnhof der PATH direkt unter dem Terminal der New Jersey Transit. |
Die sechs Gleise der Terminals in Downtown Manhattan wurden beidseitig mit Bahnsteigen ausgestattet, also mit insgesamt vier Mittel- und zwei Seitenbahnsteigen, um einen zügigen Fahrgastfluß zu ermöglichen. Zusätzlich verfügte das Hudson Terminal über einen separaten Gepäckbahnsteig. Der Gepäckverkehr, wofür besondere Wagen eingesetzt wurden, bewährte sich aber nicht und wurde nach einiger Zeit wieder eingestellt. |
|
Die Hudson and Manhattan Railroad Company, kurz H&M, zeichnete sich durch eine einzigartige Firmenphilosophie aus. McAdoo stellte das Wohl seiner Fahrgäste über alles andere, er übertrug die Maxime "Der Kunde ist König" auch auf die Eisenbahn, ganz im Gegensatz zur Verfahrensweise anderer Gesellschaften, wie z.B. der IRT. Sicherlich spielte aber auch der Aspekt eine Rolle, daß innerhalb Manhattans deutlich höhere Verkehrsströme als in Richtung New Jersey aufzunehmen waren, die einfach nicht die Zeit für eine individuelle Rücksichtnahme ließen. Die H&M jedenfalls genoß die Sympathie der Öffentlichkeit. An den Fahrkartenschaltern wurde nur weibliches Personal eingesetzt, da Mr. McAdoo den Frauen mehr Fingerfertigkeit und diplomatisches Geschick zutraute als deren männlichen Kollegen. Im Hudson Terminal wurden mobile Verkaufsboxen auf Rädern, sogenannte "Fliegende Schwadrone", eingerichtet, die mit jeweils einer Angestellten besetzt, von einem Portier immer dorthin geschoben werden konnten, wo der größte Andrang herrschte. |
|
Auch der Frauenrechtsbewegung stand die H&M aufgeschlossen gegenüber. Als einzige Gesellschaft führte sie Wagen nur für Frauen ein, ein Angebot, von dem dann aber nur Wenige Gebrauch machten. Die als "Alte-Jungfern-Zuflucht" verspotteten Wagen wurden nach einigen Monaten wieder abgeschafft. |
|
Eindeutig entwickelte sich das Hudson Terminal zur bedeutendsten Station der Hudson and Manhattan Railway. Mehrere Eisenbahngesellschaften, die jenseits des Hudson in New Jersey endeten, richteten eigene Fahrkartenschalter ein, die H&M wiederum erkannte deren Fahrscheine auf den Zubringerstrecken an. Mit der Pennsylvania Railroad entwickelte sich darüber hinaus ein besonderes Verhältnis. Am 16. April 1906 unterzeichneten beide Gesellschaften eine Vereinbarung über einen gemeinsamen Betrieb zwischen Manhattan und Newark. Dafür wurde die bestehende Strecke der Hudson and Manhattan Railway westlich von Grove Street verlängert und ein Anschluß zur ebenerdig verlaufenden Strecke der Pennsylvania Railroad, kurz PRR, hergestellt. Es wurden jeweils eigene, jedoch baugleiche Wagen beschafft, mit denen am 1. Oktober 1911 der Verkehr zwischen dem Hudson Terminal und Manhattan Transfer, einem Umsteigebahnhof zu den Zügen der Hauptstrecke Richtung Philadelphia, aufgenommen werden konnte. Kurz darauf, am 26. November desselben Jahres, wurde mit einer als Hochbahn geführten zweigleisigen Anschlußstrecke westlich von Manhattan Transfer das Zentrum Newarks erschlossen. Neben der Endstation Park Place, nördlich der Altstadt gelegen, kam ein Zwischenhalt bei Harrison hinzu. Diese Strecke wurde aber am 21. Juni 1937, ebenso wie die Station Manhattan Transfer, stillgelegt, und durch eine andere Trassenführung ersetzt. Die gemeinsamen H&M- und PRR-Züge verkehren seitdem weiter entlang der Hauptstrecke der Pennsylvania Railroad auf eigenen Gleisen, halten an der neuen Station Harrison, und enden im Bahnhof Penn Station der PRR in Newark an zwei eingleisigen, übereinanderliegenden Bahnsteigen. Hinter dem Bahnhof fand eine zweigleisige Kehranlage Platz. Am 12. April 1912 wurde auch Jersey City mit der Station Summit Avenue (heute Journal Square) an das Streckennetz angebunden, nachdem hier schon vorher die Züge ohne Halt vorbeifuhren. |
|
 |
Knapp die Hälfte des Streckennetzes der PATH verläuft oberirdisch; dann meist auf einer gemeinsamen Trasse mit der Eisenbahn (Aufnahme östlich von Journal Square) |
Es gab bei der H&M Vorstellungen zur Eröffnung weiterer Linien, so in einem Vorschlag von 1909, der eine Verlängerung Richtung Staten Island vorsah. Die Route sollte westlich von Grove Street zur Central Railroad of New Jersey abzweigen, über deren Gleise weiter Richtung Süden verlaufen, und durch einen neuen Tunnel unter dem Kill van Kull schließlich Staten Island erreichen. Ein weiteres Augenmerk richtete McAdoo auf die Ausschreibung der neuen U-Bahn-Strecken des Triborough Planes durch die Stadt New York, wofür er als Mitbewerber für seine Gesellschaft den Zuschlag erhoffte. |
|
1913 verließ William G. McAdoo die Hudson and Manhattan Railway, um in die Politik einzusteigen. Die H&M firmierte weiter als Unternehmen, jedoch setzte allmählich der Abstieg ein. Die Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahren trug ihren Anteil dazu bei. Die Fahrzeuge, der Oberbau und die Technik unterlagen dem Verschleiß; aufgrund der fehlenden Einnahmen war aber eine Erneuerung im notwendigen Maße nicht möglich. Mit dem Neubau der Sixth Avenue Line der IND wurde zwar noch ein neuer Bahnhof an der 33rd Street — als Ersatz für die im Wege stehende alte Anlage - in Betrieb genommen, trotzdem ging es weiter bergab. Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich im Jahre 1942, als ein Zug mit zu hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof Exchange Place einfuhr und die ersten vier Wagen entgleisten. Fünf Tote waren zu beklagen; eine Untersuchung ergab, daß der Fahrer unter Alkohol stand. |
|
Schließlich führte die Eröffnung des Holland- sowie des Lincoln-Autotunnels unter dem Hudson zu einem weiteren Fahrgastschwund. Ende der fünfziger Jahre war die H&M nahezu bankrott, der Zustand der Strecken katastrophal. Da regte sich Anfang der sechziger Jahre das Interesse der Stadt - jedoch nicht ursächlich aus Sorge um die Bahn, sondern wegen des Grundstücks, das das Hudson Terminal einnahm. Die Port Authority, die New Yorker Hafenbehörde, plante hier das World Trade Center. Sie übernahm die Hudson and Manhattan Railway mit der Verpflichtung, den Betrieb in eigener Regie weiterzuführen. Dafür wurde 1962 die PATH, die Port Authority Trans-Hudson Corporation, ins Leben gerufen. Mit viel Aufwand und Investitionen begann die durchgreifende Erneuerung der heruntergewirtschafteten Anlagen. Der größtenteils noch aus den Eröffnungsjahren stammende Wagenpark wurde durch neue Fahrzeuge ersetzt, Gleise wurden ausgewechselt und die Signaltechnik auf einen neuen Stand gebracht. Das alte Gebäude des Hudson Terminals mußte freilich weichen. Auch unterirdisch entstand ein neuer Bahnhof mit nur noch fünf Gleisen, einem Seiten- und zwei Mittelbahnsteigen, er trägt die Bezeichnung "World Trade Center". Der Gemeinschaftsbetrieb mit der PRR wurde nach der Übernahme durch die PATH nicht weiter aufrechterhalten. |
|
 |
Nur je ein Gleis steht der PATH in der doppelstöckigen Newark Penn Station zur Verfügung, dafür hat sie die obere Ebene ganz für sich allein. Unten befinden sich zusätzlich fünf Fernbahnsteige. |
Das 22,2 Kilometer lange Streckennetz teilen sich heute vier Linien. Die wichtigste stellt die Relation Newark - World Trade Center dar, die von Verstärkungszügen zwischen Journal Square und WTC zusätzlich unterstützt wird. Am Journal Square beginnt die zweite Hauptlinie zur 33rd Street; daneben bestehen weiterhin die Verbindungen World Trade Center - Hoboken sowie 33rd Street - Hoboken. Alle Linien werden ganztägig befahren, im Normalfall alle 10 bis 15 Minuten. Zur Rush Hour verdichtet sich der Zugabstand auf minimal drei Minuten, während der Nacht beträgt er etwa eine halbe Stunde. Obwohl die Strecken in Manhattan eng mit dem New Yorker U-Bahn-Netz verflochten sind, existiert kein Verkehrsverbund. |
|
In Harrison befindet sich die Hauptwerkstatt der PATH, hier erfolgt die Generalüberholung der (im Jahre 1992) 342 Triebwagen. Eine kleinere Anlage zur Wartung ist in Hoboken vorhanden; eine weitere, der Henderson Yard bei Grove Street, wurde vor wenigen Jahren stillgelegt und abgebaut. Westlich der Station Journal Square schließt sich eine mehrgleisige Abstellanlage an. |
|
Als Zubringer für die PATH in Newark dient die City Subway, eine Straßenbahnlinie, die in einer Wendeschleife direkt unter dem Bahnhof Penn Station endet. Ihre Besonderheit besteht zum einen darin, daß sie im engbebauten Stadtgebiet von Newark unterirdisch verkehrt, zum anderen in dem eingesetzten Fahrzeugpark. Hier sind die inzwischen selten gewordenen legendären PCC-Cars noch im Linienbetrieb anzutreffen. Die Abkürzung steht für "President’s Conference Committee", und markiert einen der Höhepunkte der Straßenbahngeschichte in der Welt. Auf der Suche nach effizienten Alternativen gegenüber der immer mehr fortschreitenden Automobilisierung taten sich die in Bedrängnis geratenen Straßenbahnbetriebe und Herstellerfirmen 1929 zusammen, und stellten ein gemeinsames Programm für den Ausweg aus der Krise auf. Daraus entstand die Idee eines neuen Großraumwagens. Dieser zeichnete sich durch eine höhere Geschwindigkeit und Beschleunigung, leichtere Bauweise, höheren Komfort, und nicht zuletzt durch seine in hoher Stückzahl geplante Anschaffung durch geringere Kosten aus. 1930 entstanden zwei Prototypen, von denen einer schließlich ab 1935 in Serie ging. Bis zur Einstellung der Produktion 1952 wurden über 5.000 Wagen gefertigt. Darüberhinaus stand dieser Typ Pate für einige Straßenbahn-Neuentwicklungen in Europa. |
|
 |
Einfahrt eines PCC-Cars in Newark Penn Station (oben), darunter die Trasse bei Norfolk Street, kurz nach Verlassen des Tunnels. |
 |
Die City Subway fungiert vor allem als Anschlußstrecke der PATH, d.h. sie übernimmt die Verteilung der Pendlerströme aus New York in die westlichen Stadtteile Newarks und sammelt sie in umgekehrter Richtung. Penn Station besitzt als zentraler Umsteigepunkt das deutlich höchste Verkehrsaufkommen. Um dort unnötig lange Wartezeiten beim Kassieren des Fahrgeldes (was zur Aufgabe des Fahrers gehört) zu vermeiden, entwickelte man ein einfaches, aber wirkungsvolles System. Wer in Richtung Bahnhof fährt, bezahlt wie gewohnt beim Einsteigen, in der stadtauswärtigen Richtung jedoch erst beim Aussteigen. |
Für die City Subway wurden die PCC-Cars zum Retter. Newark verfügte einstmals über ein ganzes Netz von Straßenbahnen. 1930 begann die Anlage einer neuen Strecke auf der Trasse des 1922 zugeschütteten Morris Canals, die die Mehrzahl der Richtung City führenden Linien bündeln und unabhängig vom Straßenverkehr in die Innenstadt leiten sollte. Die insgesamt fast sieben Kilometer lange Verbindung verläuft auf den letzten, fast zwei Kilometern unter dem Raymond Boulevard. Am 26. Mai 1935 zwischen Broad Street und Heller Parkway eröffnet, erfolgte am 20. Juni 1937 die Verlängerung bis Penn Station, und am 22. November 1940 am anderen Ende bis Franklin Avenue. Die bereits bestehenden Straßenbahnlinien wurden über Rampen angeschlossen, für das prognostizierte Verkehrsaufkommen entstand die mehrgleisige Wendeschleife mit getrennten Bahnsteigen zum Aus- und Einsteigen unter der Penn Station. Jedoch wurden auch in Newark nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer mehr Straßenbahnlinien ein- bzw. auf Bus umgestellt. Schließlich blieb nur die zuletzt angelegte, schnellbahnähnliche Strecke nach Franklin Avenue übrig. Um dieser den Bestand zu sichern, wurden 1952 von der Twin Cities Rapid Transit Company 30 PCC-Cars gebraucht erworben, mit denen der überalterte Wagenpark erneuert werden konnte. Für die Wartung wurde ein Teil der Wendeschleife zur Werkstatt und Abstellanlage umgebaut. Nach über 45 weiteren Dienstjahren machen die Wagen dank guter Pflege immer noch nicht den Eindruck, als müßten sie aus dem Verkehr gezogen werden, stattdessen versehen sie Tag für Tag ihren Dienst auf der zwar einzigen, aber beständigen Straßenbahnlinie in Newark (und im Großraum New York). |
|
